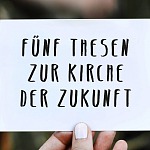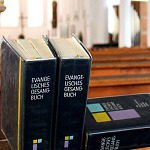Thema Monatsgruß 04 05 | 2025
Braucht Demokratie Religion?
Hier soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern Religion förderlich für die demokratische Gesellschaftsordnung ist. Dem sei vorausgeschickt, dass sich die Erläuterung vor allem auf Religion in Form der evangelischen und katholischen Kirchen in Deutschland bezieht.
Von hörenden Herzen und Ambiguitätstoleranz
Der Soziologe Hartmut Rosa ist von dem demokratiefördernden Charakter von Religion – insbesondere in Form der christlichen Kirchen – überzeugt. Dies begründet er folgendermaßen: „Demokratie bedarf eines hörenden Herzens, sonst funktioniert sie nicht. […] Meine heute zu vertretende These lautet, dass es insbesondere die Kirchen sind, die über Narrationen, über ein kognitives Reservoir verfügen, über Riten und Praktiken, über Räume, in denen ein hörendes Herz eingeübt und vielleicht auch erfahren werden kann.“ Darüber hinaus identifiziert Rosa im kirchlichen Leben ein heilsames Gegenmodell zur dynamischen Alltagsgesellschaft. In einer Welt, die die Menschen durch permanenten Steigerungszwang und Leistungsdruck zu einem wachsenden Aggressionsverhalten drängt, sei Kirche ein Ort, wo die Fähigkeit zum „Sich-anrufen-lassen“ und Hinhören eingeübt werde. Diese Fähigkeit stellt eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Kommunikation dar.
Ein anderer demokratiefördernder Aspekt von Religion liegt im Verhältnis zu ihrem Hauptbezugspunkt: dem transzendenten Gott. Christlich-religiöse Menschen pflegen ihre Gottesbeziehung in einem System, welches Gott als den dreieinigen Gott erkennt. Dabei ist dem Glaubenden jedoch bewusst, dass er in Bezug auf „das Göttliche“ keine letztgültige Wahrheit behaupten kann. Ein religiöser Mensch übt sich also darin, die Mehrdeutigkeit der religiösen Vorstellungen zu tolerieren, ja positiv wertzuschätzen. Mit dem Islamwissenschaftler Thomas Bauer kann hier von der „Ambiguitätstoleranz“ der Religion gesprochen werden. Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, andere Meinungen und Sichtweisen zu akzeptieren und entsprechende Widersprüche in Situationen und Handlungsweisen auszuhalten. Übertragen in den politischen Bereich fördert die Ambiguitätstoleranz die Kooperations- und Kompromissfähigkeit, da sie auch im demokratischen Diskurs die eigene Position nie absolut setzt, sondern nach der vorläufigen, bestmöglichen Lösung sucht.
Demokratieaffinität in der Bibel
Die demokratischen Grundprinzipien „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ lassen sich auch in den Bibelschriften identifizieren. Das Freiheitsprinzip begegnet in der hebräischen Bibel vor allem im Kontext der Exoduserzählung. Jahwe, der Gott Israels, befreit sein Volk aus der Gefangenschaft und führt in die politische Eigenständigkeit. Im Neuen Testament ist das Freiheitsprinzip für das Heilswirken Jesu Christi zentral. Sein Leben, sein Tod und seine Auferweckung werden als Befreiung von der Macht der Sünde gedeutet. In diesem Sinne schreibt Paulus: „Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen!“ (Galater 5,13)
Das Gleichheitsprinzip findet sich in der schöpfungstheologischen Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit des Menschen (vgl. Genesis 1,27). Sie begründet eine unverlierbare und ihrer Qualität nach absolut gleichwertige Würde jedes Menschen unabhängig von sozialem Status oder persönlichem Verdienst. Ebenso ist der Mensch nach biblischer Auffassung gleichgestellt in seiner persönlichen Verant-wortung vor Gott. Reiche wie Arme, Starke wie Schwache, Frauen wie Männer hoffen in letzten Dingen gleichermaßen auf die unverdiente göttliche Gnade, die ihnen gleichermaßen zuteil wird.
Das Prinzip der Brüderlichkeit – oder zeitgemäßer formuliert: das Prinzip der gerechten Teilhabe – ist ebenfalls prominent in der Bibel. Für das Alte Testament ist die Fürsorge für soziale benachteiligte Gruppen wie Witwen oder Waisen eine religiöse Pflicht (vgl. z.B. Deuteronomium 24,6f.). In den Evangelien wiederum ist Jesu Hinwendung zu ausgegrenzten Personengruppen vielfältig belegt (vgl. z.B. das Gleichnis vom Großen Abendmahl in Lukas 14,15ff.)
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es in zentralen Motiven der Bibelschriften auffällige Affinitäten zum demokratischen Ethos gibt. Der Umkehrschluss liegt nahe, dass sich eine christlich-religiöse Lebensweise in demokratischen Strukturen wohl bestmöglich entfalten kann.
Fazit: Demokratie braucht Religion, wenn…
Die oben aufgezählten Punkte zeigen, dass Religionen wie das Christentum für eine demokratische Gesellschaft tatsächlich unterstützend wirken. Allerdings ist das kein Automatismus. Damit es zu diesem Effekt kommt, muss die jeweilige Religion auch die ihr innewohnenden, demokratieaffinen Aspekte (Ambiguitätstoleranz, ethisches Verhalten) fördern. Tut sie dies nicht, kann Religion der Demokratie unter Umständen sogar schaden. Wenn eine Religionsgemeinschaft beispielsweise die eigene Transzendenzwahrheit absolut setzt, wird anstelle von Toleranz ein exklusives, dualistisches Weltbild verstärkt. Studien belegen eine Korrelation zwischen solch einer „monoreligiösen Orientierung“ und demokratiefeindlichen Einstellungen wie Fremdenfeindlichkeit oder Sexismus. Ähnlich demokratiehemmend wirkt ein Glaubensverständnis, welches das politische Handeln mit Verweis auf eine bevorstehende Endzeit oder das Jenseits grundsätzlich in Frage stellt. Wenn die evangelische Kirche also ihren prodemokratischen Kurs beibehalten will, muss sie ihr Gemeindeleben und ihre Verkündigungspraxis auf ihre demokratiefördernden Aspekte befragen und diese weiterhin stark machen.
Philipp Müller, Pfarrer